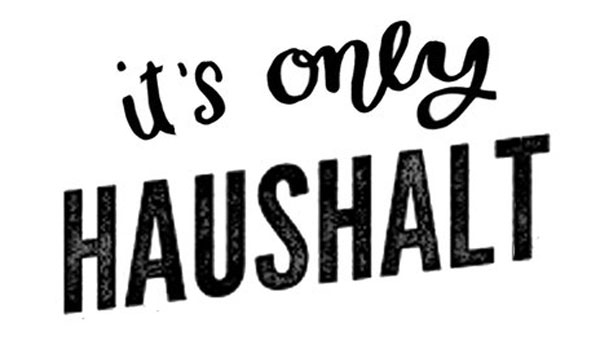Das bisschen Haushalt …
In der heutigen Zeit ermisst sich die Relevanz eines Themas durchaus auch in den erzielten Ergebnissen, die dir eine Google-Suche ausspuckt. Und ja klar: Am Anfang einer journalistischen Recherche steht stets das Eintippen der entscheidenden Schlagwörter in die Suchmaschine. Und die hat dann gefälligst zu spucken. Doch obwohl mir innerhalb von 0,7 Sekunden über 203 000 Ergebnisse zum Schlagwort “Haushalt” entgegen rieselten, war eine digitale Recherche wohl selten so unergiebig und doch so vielsagend wie meine Suche nach Anknüpfungspunkten zum vorliegenden Essay. Denn “Haushalt” lässt sich nicht googeln, jedenfalls nicht so, wie es dieser Text, der ja idealerweise Querverbindungem, Verweise und Zitaten freilegen soll, eigentlich verlangt. Das liegt vor allem an der semantischen Mehrdeutigkeit des Wortes, aber eben auch daran, dass das Internet vor allem verkaufen möchte. In diesem Fall: Besen, Waschmittel, Staubwedel.
Unter diesen Eindrücken jedenfalls materialisiert sich eine erste These, die uns im Folgenden begleiten wird: Haushalt ist immer das, was man nicht sieht und was man nicht sehen soll.
Staub, Dreck, Schmutz, Müll – in Zimmern und Schränken, hinter und unter Möbeln, auf der Wäsche und auf dem Besteck, verschont Niemanden, der lebt. Ein ziemlich faires Konzept. Zumindest auf den ersten Blick. Und obwohl jeder von uns weiß, dass sich seine Gegenüber, Nachbarn und Freunde mit den gleichen lästigen Tätigkeiten abmühen, sind wir Teil eines gesellschaftlichen, beinahe moralischen, aber eben auch stummen Überwachungssystems. Warum aber wird nicht offen, laut und ehrlich über Haushalt geredet und gerantet? Das liegt vor allem am Standing der haushaltlichen Arbeit.
… macht sich von allein, sagt mein Mann
Und ja, hier trampelt ein Elefant durch den Raum, dass alle Wassergläser wie in “Jurassic Park” Wellen schlagen. Das schlimmste: Der Elefant summt einen Schlager. “Das bisschen Haushalt” von Johanna von Koczian, mittlerweile längst geflügeltes Wort und Alltagsmeme, so fest verankert im kollektiven Gedächtnis, dass ein, zwei Triggerworte ausreichen, um es dir sofort in Wurmform durch die Gehörgänge kriechen zu lassen. Doch eben weil der Text des Schlagers mittlerweile längst auf schunkelnden Schenkeln totgeklopft wurde, vergisst man schnell um die Prägnanz des Textes: “Das bisschen Haushalt macht sich von allein | Sagt mein Mann | Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein | Sagt mein Mann | Wie | eine Frau sich überhaupt beklagen kann | Ist unbegreiflich | Sagt mein Mann”, heißt es im 1977 erschienen Evergreen. Die Rollenverteilung der lyrischen Figuren ist eindeutig: Einerseits der hart arbeitende Mann, andererseits die Hausfrau, die es sich erdreistet, dem ausgelaugten Geldverdiener ihr Leid ob der bisschen Hausarbeit zu klagen. Diese Konstellation wird im Text nie hinterfragt, ist aber selbstredend ironisch gebrochen. Und ebendieser Bruch hat einen durchaus komplexen Hintergrund, dessen Schemata sich bis heute abzeichnen.
Im Erscheinungsjahr des Schlagers trat in Deutschland das “Erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts” in Kraft. Zuvor hieß im 1957 in Kraft getretenen Gleichberechtigungsgesetz: „Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“ Frei übersetzt: Bis Ende der 70er durfte eine Frau nur arbeiten, wenn sie zuvor den Haushalt erledigt hatte. Kurzer Exkurs: Um der vermeintlichen Hysterie der Frauen vorzubeugen, hatte die Pharma-Industrie in den 1930er Jahren eine wirklich unfassbare Taktik entwickelt: “Pervetin”, hergestellt aus Methamphetamin-Hydrochlorid und besser bekannt als “Hausfrauenschokolade” sollte schlechter Stimmung zu Haus vorbeugen – war aber, Sie ahnen es, nichts anderes als rezeptfreies Crystal Meth.
Staub, Dreck, Schmutz, Müll – in Zimmern und Schränken, hinter und unter Möbeln, auf der Wäsche und auf dem Besteck, verschont Niemanden, der lebt. Ein ziemlich faires Konzept. Zumindest auf den ersten Blick. Und obwohl jeder von uns weiß, dass sich seine Gegenüber, Nachbarn und Freunde mit den gleichen lästigen Tätigkeiten abmühen, sind wir Teil eines gesellschaftlichen, beinahe moralischen, aber eben auch stummen Überwachungssystems. Warum aber wird nicht offen, laut und ehrlich über Haushalt geredet und gerantet? Das liegt vor allem am Standing der haushaltlichen Arbeit.
Das bisschen Haushalt …
Die hochgradig konservative und in klebriger Bürgerlichkeit verankerte Position der eindeutigen Rollenbilder wurde ab den 70er Jahren zusehends dekonstruiert. Umso hanebüchener erscheint es, das sich selbst heute, also mehr als 40 Jahre später, immer noch verquere Rollenbilder in der Gesellschaft verkantet haben, die den Mann als Ernährer und Arbeiter und die Frau als Hausfrau und Mutter verordnen. Passend dazu geisterte dieser Tage ein Zitat der Moderatorin Collien Fernandez aus einem Interview mit YouFm durchs Netz: “Viele Frauen hören oft: ‘Ach, das ist aber nett, dass dein Mann dir im Haushalt und mit den Kindern hilft.’ Diese Formulierung zeigt schon, dass all das als Aufgabe der Frau angesehen wird und wenn der Mann superlieb und freundlich ist, dann hilft er ihr. Aber er hilft ihr nicht. Denn all das ist nun mal auch seine Aufgabe.”
Und genau in diesen Narrativen gründet das kaum vorhandene Ansehen der häuslichen Arbeit: Sie bringt kein Geld ein. Mehr noch: Sie kostet Geld. Für Lebensmittel und Putzmittel.
An der Stelle wollen wir nicht zu weit greifen, aber im gleichen Atemzug müssen wir auch Felder wie etwa die Kranken- und Altenpflege und pädagogische Berufe nennen, Jobs also die die jüngere Geschichte primär als “Frauenberufe” abgestempelt hatte und die auch deshalb bis heute sträflich unterbezahlt sind.
Ein ziemlich ekelhafter, vom Patriarchat aufgezogener Kreislauf. Der Haushalt markiert hier nur die für ewig vom Wasser verborgene Spitze des umgedrehten Eisbergs – auch wenn einem Großteil von uns natürlich klar ist: Haushalt geht uns alle an. Und Haushalt verschont Niemanden.
Bedeutet aber auch: Während wir unsere Brotjobs über weite Teile unserer Lebenszeit abnicken, absitzen und akzeptieren, weil sie durch Bezahlung am Ende des Monats ihre Relevanz verteidigen, nehmen wir den Haushalt als nervigen Zeitenfresser war und verschieben ihn deshalb in den toten Winkel unseres Alltags. Definiert man die Arbeit Hausfrauen und Hausmänner, da lautet die Antwort nicht selten: Er / Sie arbeitet nichts. Der Blick in die Geschichte zeigt indes, dass es durchaus alternative Modelle hierzu gab. Der Blick zu den alten Griechen offenbart den Begriff “Oikos”, aus dem sich später die Wörter “Ökologie” und “Ökonomie” entwickelten. “Oikos” bezeichnete die Gesamtheit von Familie (inklusive Sklaven und Bediensteten), Land, Häusern und alles was darin kreuchte und fleuchte. Zwar stand an dessen Spitze eine klassischer Patriarch, doch laut Sokrates Schüler Xenophon lag die Autorität über den “Oikos” inklusive allen finanziellen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten vollends bei der Frau. Und auch wenn wir hier von hyperpriviligierten Adelsgeschlechtern sprechen, so eröffnet sich hier doch eine andere Sichtweise auf den Berufsstand der Hausfrau.
… kann so schlimm nicht sein
Doch selbst in der Kunst findet der Haushalt nur seltenst statt und das obwohl Alltagsdarstellungen beispielsweise tief in der Geschichte der Malerei rückverankert sind. Haushalt ist also nicht nur die Arbeit hinter der Arbeit sondern auch der Alltag hinter dem Alltag. Eine der wenigen Ausnahmen markiert das Gemälde “Ein Paar mit einem Papagei” von Pieter de Hooch, auf welchem besagte Turteltäubchen von in Schatten getunkten Putzutensilien umrahmt werden. Mit diesem merkwürdigen Framing geht ein feinfühlig aufgezogenes Szenario einher, das uns Rezipienten zu heimlichen Beobachtern aus der hinterkulissigen Besenkammer macht und auf nächster Ebene den Verdacht nahelegt, dass die dargestellte Affäre des Paares wohl er verheimlicht werden sollte.
Mit ganz anderen Verstrickungen zwischen Kunst und Haushalt hatte Joseph Beuys zu tun, dessen Arbeiten gleich zweimal Opfer von Putzwütigen wurden: Bereits 1973 hatten Mitglieder des SPD-Ortsverein Leverkusen-Alkenrath Beuys für eine nahende Ausstellung eingelagertes Werk “unbetitelt (Badewanne)” geschrubbt um darin Sektgläser zu spülen – die Aktion wurde Vorbild für einen Werbespot des Waschmittels “Ata”: 1986 (sechs Monate nach dem Tod des Künstlers) entfernte der Hausmeister der Düsseldorfer Kunstakadamie die Arbeit “Fettecke”, die daraufhin zum vielleicht bekanntesten Beuys Werk reifte und entscheidend dazu beitrug, dass wir uns heute immer wieder den unsäglichen Spruch “Ist das Kunst oder kann das weg” anhören müssen.
Viel homogener und kreativer verankert ist der Haushalt und seine Geräusche in der neuen und experimentellen Musik. Hier stichst du in ein regelrechtes Wespennest der Klangprojekte. Vom britischen Musikproduzent Matthew Herbert der für ein Album ausschließlich Sounds aus dem Offenbacher Club “Robert Johnson” sampelte (inklusive Toilettenspülung und Küchenklirren). Über die berühmt gewordenen Videoschnipsel “Küchenmusik” der ersten Popakademie, welches Musik in ziemlich verschrobener Art und Weise in Industrieküche musizieren lässt. Oder die Kinderoper “Teufels Küche” des hochdekorierten Komponisten Moritz Eggert. Bis hin zum Wiener Gemüseorchester, das seine Instrumente komplett aus – naja – Gemüse schneidet, aber auch Geräte wie Entsafter oder Mixer einsetzt.
Und erst hier wird klar, was Haushalt eben auch bedeutet: Heimat. Und aufwachsen. Erforschen. Mit Kinderaugen. Und Kinderhänden. Wenn es aus der Küche tönt und dröhnt. Wenn du selbst Kochlöffel und Topf zum Schlagzeug umbaust. Und schlägst und schlägst im Takt deiner ureigenen Anarchie und im Rhythmus von Staubsauger und Spülmaschine.




Jeremias Heppeler
Jeremias Heppeler versteht sich als intermedialer, bildender Künstler, der Medien (Film, Bild, Text) analog und digital kombiniert und dabei versucht neue, hybride Räume zu erschließen. Das Experiment der stetigen De- und Rekontexstualisierung steht im Zentrum seiner Arbeit.