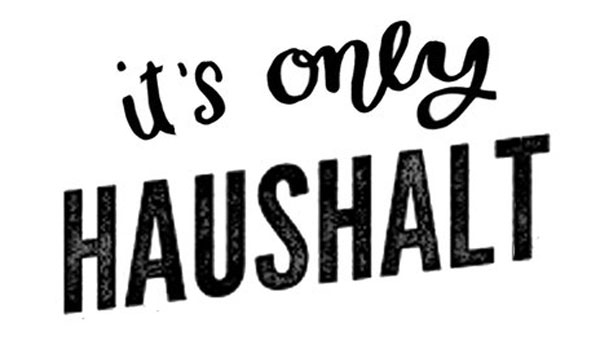Mutterschaft – Mutter schafft
Aktuell begegnet sie mir oft, die Frage, die nicht neu ist und mich doch immer wieder fassungslos macht: «Arbeitest du eigentlich was oder bist du nur Mutter?»
Meine Kinder sind neun Jahre, zwei Jahre und vier Monate alt. Und ja, ich arbeite was. Zum Beispiel schreibe ich Texte für Zeitungen und Magazine, so wie diesen hier. Das ist mein Beruf, das habe ich gelernt, das macht mir Spass und damit verbringe ich zurzeit in etwa zwei Stunden am Tag, wenns gut läuft. Deshalb kann ich im Antrag meiner Krankenkasse in das Kästchen hinter «Beruf» das Wort «Journalistin» setzen.
Dass ich die restlichen Stunden meines Tages nicht am Schreibtisch verbringe, sondern mit meinen Kindern und Hausarbeit, das fällt hinten runter. Das ist ja auch kein Beruf und somit keine Arbeit. Ich sitze aber nicht toujours Latte-Macchiato-trinkend im Café, sondern bin rund um die Uhr beschäftigt. Mit den unterschiedlichsten Aufgaben, die ich nicht studiert, sondern mir so nach und nach angeeignet habe.
Nach zehn Jahren im Business ist das so einiges. Ich bin Restaurantleiterin, Alleinunterhalterin, Bildungsexpertin, Sanitäterin, Juristin, Modespezialistin, Ernährungswissenschaftlerin, Sporttherapeutin, Frisörin, Fahrradmechanikerin, Kunstvermittlerin, Vorleserin, Psychologin, Reinigungskraft und Profimanagerin – alles in einem. Kurz: Ich bin Mutter.
Also habe ich das beim Antrag meiner Krankenkasse so eingetragen. Beruf: Journalistin, Arbeitsstunden pro Woche: 10. Dann habe ich noch ergänzt: und Mutter, Arbeitsstunden pro Woche: 168. Der Antrag wurde wieder zurückgeschickt, mit der Bitte um mehr Ernsthaftigkeit.
Aber das ist mein Ernst. Eine Familie zu versorgen, ist Arbeit, man ist in ständiger Rufbereitschaft, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Kinder zu haben ist so wie ein Festival…
Wenn mich kinderlose Freunde fragen, wie es läuft bei mir, dann versuche ich es so zu beschreiben:
Das Leben mit Kindern ist ein bisschen wie ein Festival. Nicht dass wir uns falsch verstehen: Ich mag Festivals sehr gerne! Im Optimalfall sind sie laut, wild und dreckig, man schläft wenig und hat lustige Menschen um sich rum. Man isst komische Sachen und trägt lässige Klamotten, meistens irgendwas mit Gummistiefeln oder man ist barfuss. Manchmal ist es einem krass zu viel, man ist müde und will eigentlich nur wieder heim ins Bett oder duschen. Und es gibt auch die richtigen Abfuck-Momente, wenn es ins Zelt regnet, im letzten Bier eine Nacktschnecke dümpelt und vor dem Dixi 20 Leute anstehen. Aber dann kommt von irgendwoher wieder cooler Sound, man rafft sich auf, geht Weitertanzen und die schlechte Laune verfliegt, es ist wieder geil, bis zum Sonnenaufgang.
Mit Kindern ist das Feeling so ähnlich. Nur dass man das Festival nicht besucht, sondern organisiert. Mit DJs, Catering, An- und Abfahrtslogistik, Toilettenanlagen, Sanitätern und allem Pipapo. Hinzu kommt, dass der Spass nicht nach drei Tagen vorbei ist, sondern knallhart weitergeht. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Es gibt keinen Feierabend, keinen Urlaub, kein Sabbatical, keine Kündigung. Manchmal beginnt die Schicht schon um 5:30 Uhr. Und manchmal endet sie erst dann.
Oft kommt mir ein Satz meiner Hebamme in den Sinn. Im Geburtsvorbereitungskurs hat sie gesagt, dass frischgebackene Eltern nicht so viel jammern sollen wegen des Schlafmangels, man sei die Jahre zuvor schliesslich auch gut mit wenig Schlaf und vielen lauten Nächten klargekommen, also könne man sich auf das Baby freuen – da komme das wieder. Festival-Feeling für zuhause, also.
…nur dass man das Festival organisiert!
Am deutlichsten spüre ich den Rock’n’Roll, wenn ich morgens einen Arbeitstermin habe. Während mein Gegenüber meist noch schlaftrunken im ersten Kaffee rührt, habe ich schon den ersten Halbmarathon hinter mir. Kinder geweckt, gewaschen, angezogen, Frühstück zubereitet, Essen in kleine Quadrate geschnitten und in Dosen verpackt, passende Schuhe, Socken, Mützen zusammengesucht und irgendeine mittlere Katastrophe bewältigt (Hausaufgaben vergessen, Lieblingsshirt in der Wäsche, falsches Müsli, irgendwas ist immer) und alle Kinder in die jeweils zuständige Institution gebracht.
Aber wie schon gesagt, ich mag mein kleines Festival. Und ich finde es vollständig okay, dass es Menschen gibt, die anders sind. Mehr so die Philharmonie-Typen, morgens ihre Zeitung lesen zu klassischer Musik – es sei jeder und jedem gegönnt. Was mich ärgert, ist die Wahrnehmung von manchen Teilen der Gesellschaft, die eben nicht sehen, dass es Arbeit ist, die man leistet im Leben mit Kindern.
Und das ist kein reines Frauenthema, nicht die Mutterschaft allein ist anstrengend. Das gilt für Väter genauso. Auch für Paare mit der 50er-Jahre-Rollenverteilung. Dann ist der Mann nämlich auch pausenlos eingebunden und gefordert, erledigt Einkäufe in der Mittagspause oder auf dem Heimweg vom Job, kocht das Abendessen, checkt die Hausaufgaben, bringt die Kinder ins Bett und räumt dann noch die Küche auf (im Best Case).
Familie ist kein Frauenthema
Er läuft nachts mit dem weinenden Baby durch die Wohnung, um am nächsten Morgen wieder frisch und fröhlich im nächsten Meeting zu sitzen und ist generell auch 24 Stunden am Tag auf Abruf.
Auch das fällt hinten runter, bei der Frage nach Arbeit und Mutterschaft, die Vätern nämlich äusserst selten gestellt wird. Dem zu Grunde liegt eine sehr einseitige Definition des Arbeitsbegriffs, der sich ausschliesslich auf die Erwerbsarbeit fokussiert.
Care-Arbeit ist damit nicht gemeint. Und es ist mir schon klar, dass es sich bei meiner Reizfrage vielleicht auch nur um eine flapsige Formulierung handelt. Es ist halt einfach kompakter als zu fragen: «Gehst du derzeit neben deiner sehr, sehr zeitintensiven und anstrengenden Aufgabe als Mutter auch anderen Tätigkeiten nach, mit denen du im besten Fall noch Geld verdienst?»
Wenn Care-Arbeit anerkannt werden würde, gäbe es diese bescheuerte Frage nach Arbeit oder Muttersein nicht mehr. Und dann gäbe es einen Funken Solidarität mit Eltern. Das würde beinhalten, dass man Familien jede Unterstützung zukommen lassen würde, die nur irgendwie möglich ist. Sei es in Form von Zeit oder von Geld.
Autorin: Veronika Fischer
Der Text erschien auf www.saiten.ch